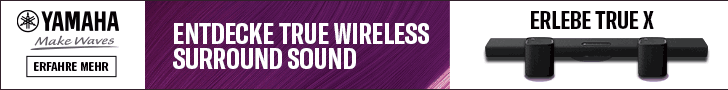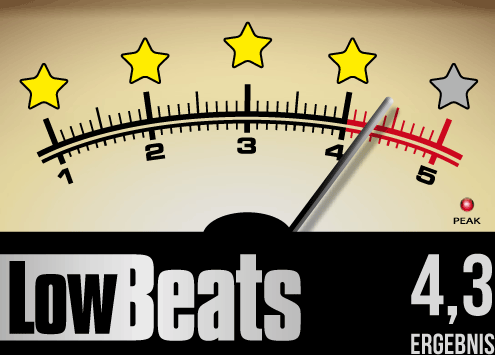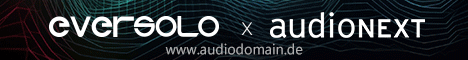Extravagant wie immer, differenziert wie selten: Auf Tori Amos Native Invader erweitert die Pianistin und Sängerin ihre kammermusikalische Songwriterkunst um Klänge von Art-Rock bis TripHop. Sie singt über ihre Vagina (Under The Pink, über eine erlittene Vergewaltigung („Me And A Gun“) oder über schicke Jungs, die sie der hawaiianischen Göttin des Feuers zu opfern gedenkt (Boys For Pele): Sie ist sozusagen die Elfriede Jelinek der Popmusik.
Ähnlich wie die österreichische Schriftstellerin geht sie Themen an, die das Gros der Branche meidet, watet sozusagen durch die seelischen Feuchtgebiete und suhlt sich darin mit einer Intensität, die den Zuhörer dazu zwingt, sich zu positionieren. Man kann ihre Lieder als feministische oder humanistische Statement lieben oder als gespreizte One-Woman-(Nabel-)Show betrachten – teilnahmslos ignorieren lassen sie sich kaum.

Wer einmal gesehen hat, wie sich sich bei Konzerten lasziv um ihren Bösendorfer-Flügel windet, wer Interviews kennt, in denen sie anklingen lässt, was man bzw. Frau mit einer Gurke so alles anstellen kann, der weiß auch um die erotischen Komponenten ihrer Kunst. Dabei waren ihre Arbeiten nie nur simple Akte der Provokation, sondern von Anbeginn an sensible, sensitive Songwriterkunst unter pianistischen Vorzeichen.
Was in ihrem Werk einem Faible für Abgründiges entspringt und was der Selbsttherapie der eigenen inneren Dämonen, lässt sich dabei nur schwer voneinander trennen. Die dunklen Seiten der menschlichen Existenz haben die Pfarrerstochter aus North Carolina jedenfalls weiterhin fest im Griff.
Diesmal sind es die Geister der Natur, mit denen sie auf Tori Amos Native Invader ringt und die der Mensch gegen sich aufbringt – selbst als Einheimischer, keineswegs nur als Eindringling. Aber selbstverständlich hat eine denkende, reflektierende Songpoetin wie Tori Amos auch das Politische im Blick – ihre Lieder gelten auch den Trumps dieser Welt, die Konflikte, Kriege schüren, um eine Gesellschaft zu spalten, „bis es keine Seite mehr gibt, die wir einnehmen könnten“ wie es in „Breakaway“ heißt.
Suchte sie in ihren bisherigen Werken für ihren Themenkosmos oft eine kammermusikalische Reduktion, eine Nähe zur Klassik, so gibt sich dieser weibliche Vulkan am Piano diesmal popnäher. Auch auf Tori Amos Native Invader dominieren ihr feenartiger Mezzosopran und der voluminöse Ton ihres Bösendorfer-Flügels.
Aber explizit wie selten zuvor bezieht sie eine kleine Band in ihrer Arrangements ein, allen voran den Gitarristen Mac Allen, der eine Fülle unterschiedlicher Schattierungen von vibrierenden Wah-Wah-Effekten („Broken Arrow“) bis zu diffusem Flirren („Wildwood“) aus den Saiten fieselt.
Auch merkwürdige, so verspielte wie verstimmte Elektroniksounds und eine stärkere rhythmische Ausdifferenzierung sorgen für Reibungspunkte – in „Wings“ pluckern verhangene Triphop-Grooves, „Windows“ bringt rollende, minimalst Reggae basierte Beats; „Up the Creek“ vibriert geradezu in Vintage-Elektronik, flirrenden Streichern und einem atemberaubend schnellen Takt.
Nicht immer schält sich dabei eine so prägnante Melodie heraus wie in „Cloud Riders“, aber das Niveau in Sachen Sensitivität, Ausdrucksstärke und Spiel- (und Klang-)technik ist durchweg exquisit. „Native Invader“ bringt musikalischen Expressionismus, der mit feinster Feder gezeichnet ist und plakative Posen nicht nötig hat.
Der ergreifende Ausklang: „Mary’s Eyes“, gewidmet ihrer von einem Schlaganfall gezeichneten, halbseitig gelähmt und nicht mehr des Sprechens fähigen Mutter und dem Rätseln darüber, was sich wohl hinter Marys Augen abspielt.
Tori Amos Native Invader sind unterm Strich 62 Minuten akurate Komponier- und Arrangierkunst, die den Hörer in ihrer Komplexität und Eindringlichkeit fesseln, aber fraglos auch etwas erschöpfen – so wie ein gutes Gespräch unter Freunden über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens.

Tori Amos Native Invader gibt es als Audio-CD, Vinyl LP und als MP3-Download.
Bewertungen
MusikKlangRepertoirewertGesamt |